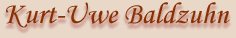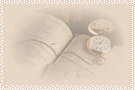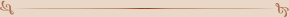Der "Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands", später "Deutscher Kulturbund" und
"Kulturbund der DDR" heute "Kulturbund e.V.", ist eine der interessantesten Organisationen der
SBZ/DDR. Als "Bund der Kulturschaffenden und Freunde der Kunst und Wissenschaft" im Juni 1945 gegründet,
entwickelte er sich zum Dachverband der künstlerisch- kulturell Interessierten und überlebte das
Ende der DDR.
Für Sachsen-Anhalt lassen sich drei Gründungsphasen erkennen:
Phase 1:
Vom August bis Dezember 1945 wurden auf Initiative der örtlichen Kulturträger, also Pfarrern,
Lehrern und Bürgermeistern Kulturbundgruppen gegründet. In Ballenstedt hatte sich bereits Anfang
August eine Ortsgruppe gebildet. In Bernburg und Dessau waren entsprechende Vorbereitungen im Gange.
Für Dessau sind Protokolle eines vorbereitenden Ausschusses erhalten. Dieser tagte seit November
1945 regelmäßig. Im Protokoll vom 27.12.1945 wird vermerkt, dass Herr Dr. von Back einen Bericht
über seine Reise zur Zentralleitung des Kulturbundes in Berlin gab. Beide Ortsgruppen wurden im
Januar/Februar 1946 gegründet. Ähnliches gilt für Freyburg/Unstrut und Wernigerode.
Charakteristisch für diese Phase ist die Mitwirkung von Personen, die in den ehemaligen
Geschichts-, Heimat- oder Kunstvereinen Vorstandsfunktionen hatten.
Phase 2:
Mit Datum vom 21.01.1946 erlässt der Präsident der Provinz Sachsen Ausführungsbestimmungen zur
Verordnung über die Einrichtung von Volksbildungs-Abteilungen bei den Bezirkspräsidenten, Landräten
und Oberbürgermeistern. Darin heißt es:
"Die Abteilung Volksbildung hat insbesondere die Aufgabe: 1. Gewinnung
breitester Volkskreise für die Idee der neuen aktiven Demokratie. Beseitigung aller Reste der
Nazi- und militaristischen Ideologie. 2. Die Förderung des Kulturbundes zur demokratischen
Erneuerung Deutschlands."
Anders gesagt: die Förderung des Kulturbundes war eine staatliche Aufgabe.
So "von Amts wegen" unterstützt entstanden in den Jahren 1946 und 1947 Hunderte von Ortsgruppen.
Phase 3:
Ab 1948 entstanden nur noch sporadisch Ortsgruppen. Zumeist dann, wenn sich Interessierte vor
Ort zusammenfanden, um eine Organisationsform für ihre Ziele zu finden. So etwa in Kelbra, wo
Theater- und Literaturbegeisterte unter Leitung des Lehrers Uwe Franke im Jahr 1949 eine Ortsgruppe
gründeten. Selbst der Mitgliederzuwachs im Zuge der Verordnung vom 12.1.1949, in dem Hunderte von
Laienspiel-, Briefmarkensammler-, Aquarianer- und sonstige Gruppen dem Kulturbund zugewiesen
wurden, führte nur begrenzt zur Neubildung von Ortsgruppen. Als singuläres Kuriosum darf der
Befehl zur Gründung der Ortsgruppe Oschersleben gelten. So schreibt der Militärkommandanten
für Stadt und Kreis Oschersleben, Held der Sowjetunion Oberstleutnant Sjedko, am 15.03.1946, an
den Landrat:
"Es ist unbedingt notwendig, das sich Herr Füßmann, Leiter des Kulturamtes,
mit den Antifa-Parteien in Verbindung setzt und unverzüglich die Organisierung des Kulturbundes
unternimmt, der bis zum 20.03.1946 gegründet werden soll."
Für meine Studie zum Kulturbund in Sachsen-Anhalt habe ich Archivmaterial gesichtet, Zeitzeugen
befragt und Sekundärliteratur ausgewertet.
Ein Exkurs zur Landesgeschichte und zum Alltag in der SBZ/DDR zwischen 1945 und 1952 erläutert
die administrativen Verhältnisse und alltäglichen Prämissen. Denn ohne deren Kenntnisse lassen
sich die Entwicklung des Landesverbandes und vor allem die Arbeit der Ortsgruppen nur schwer
einordnen. Dazu gehören: die Beschreibung der territorialen Gegebenheiten, die Änderungen der
Verwaltungsstruktur und der Aufbau der Verwaltung. Das Verhältnis zwischen deutscher Bevölkerung
und sowjetischer Besatzungsmacht wird, ebenso wie die Versorgungsfrage, unter dem Aspekt der
Kulturbundarbeit beleuchtet.
Der "Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands" war keine originäre Erfindung der
KPD/SED. Ebenso wenig war die staatlich organisierte Zusammenfassung der Intellektuellen in
einem "Kulturbund" eine Erfindung der SBZ/DDR. Das gab es schon im Kaiserreich und vor allem
in der Weimarer Republik. Diese staatlich initiierten und parteieigenen Organisationen und deren
thematische, personelle und strukturelle Wirkung auf den Kulturbund nach 1945 werden in einem
eigenen Kapitel vorgestellt. Dies beginnt mit dem "Kulturbund deutscher Gelehrter und Künstler"
von 1914, geht über zum "Sozialistischen Kulturbund" der SPD (1926-1933) und skizziert die
Tätigkeiten des "Jüdischen Kulturbundes" (1933-1940) und der Exilorganisation
"Freier Deutsche Kulturbund" (1938-1947)in London.
Die Entwicklung des Landesverbandes wird in sieben Themenkreise gegliedert:
- Gründungsphase
- Aufbauphase
- Finanzierung
- Mitgliederentwicklung
- Tätigkeitsspektrum
- Der Kulturbund im gesellschaftlichem System der SBZ/DDR
- Die Ortsgruppen
Die wichtige Frage: Wer waren die Akteure und woher kamen sie?, wird mit biographischen
Skizzen und Biogrammen beantwortet. Diese sollen ebenso wie die kommentierte Quellenedition und
die Zeittafel als Grundlage der weiteren Regional- und Heimatforschung verstanden werden.
Ein wissenschaftlicher Apparat mit Quellen- und Personenverzeichnis rundet die Arbeit ab.
Wichtige Dokumente werden in einem gesonderten Anhang zitiert.
Im
Downloadbereich
stehen Ihnen das Inhalts- und Personenverzeichnis sowie die kommentierte
Quelleedition als pdf-Dateien zur Verfügung.
Das Buch kann
hier bestellt
werden.

|